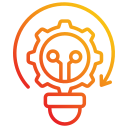This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.

Smart Contracts: Die Veränderung der Rechtslandschaft
Smart Contracts verändern die Art und Weise, wie Verträge geschlossen, verwaltet und durchgesetzt werden. Als automatisierte, digitale Vertragswerkzeuge nutzen sie Blockchain-Technologien, um Vereinbarungen zwischen Parteien ohne zusätzliche Mittelsmänner umzusetzen. Dieser technologische Fortschritt birgt das Potenzial, zahlreiche juristische Prozesse zu automatisieren und zu vereinfachen. Damit stellen Smart Contracts die herkömmlichen rechtlichen Strukturen auf die Probe und eröffnen Chancen für effizientere und transparentere Abläufe. Diese neue Ära digitaler Verträge verändert nicht nur die technische Infrastruktur des Vertragswesens, sondern wirkt sich auch auf rechtliche Konzepte, Haftungsfragen und die Rolle von Anwälten und Notaren aus.
Die Funktionsweise von Smart Contracts

Rechtliche Auswirkungen und Herausforderungen
Vertragliches Verständnis und Auslegung
Haftungsfragen bei Fehlern und Manipulationen
Beweisführung und Gerichtsfestigkeit
Smart Contracts in der Praxis